Warum wir lieber Opfer bleiben
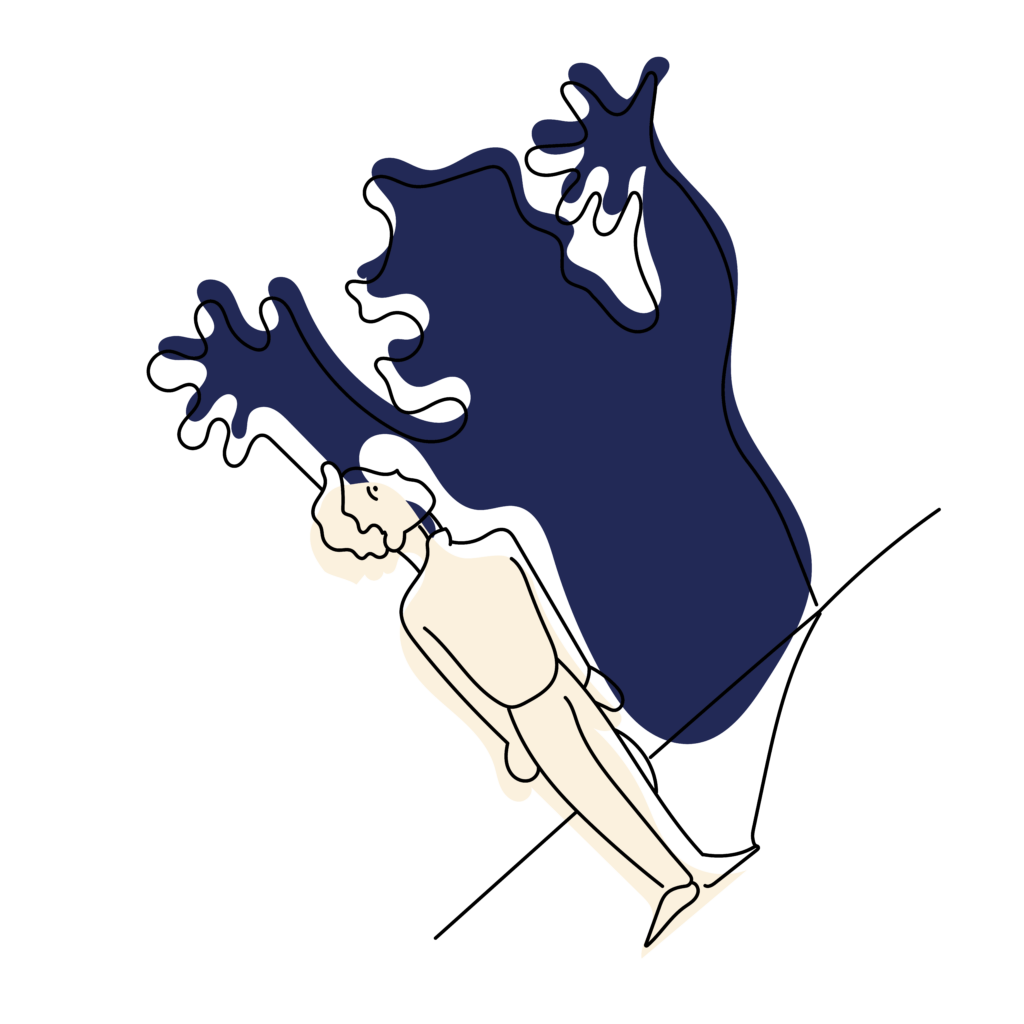
Das Wort „Opfer“ bezieht sich in diesem Artikel ausdrücklich nicht auf Menschen, die durch ein Vergehen oder Verbrechen, durch katastrophale Ereignisse, Verfolgung, Kriegshandlungen oder Unfälle physisch oder psychisch geschädigt worden sind. Ich verwende daher den Begriff „Opfer“ im Folgenden ausschließlich als Ausdruck einer bestimmten Haltung gesunder Menschen, die grundsätzlich in der Lage sind, selbst etwas an einer für sie belastenden Situation zu ändern.
Ist man erst einmal in die Opferrolle geraten, ist es unglaublich schwer, wieder herauszukommen. So bleiben manche Menschen ihr ganzes Leben lang in dieser Haltung – in der Erwartung, alle anderen mögen sich doch endlich ändern.
Wenn das Bewusstsein für das eigene Verhalten fehlt, ist natürlich auch das Bewusstsein für den Bedarf an Veränderung nicht vorhanden. Es ist wie bei den meisten Mustern und Verhaltensweisen: Oft wissen wir gar nicht, dass wir damit leben. Wir alle, ob vom Fach oder nicht, sind bei uns selbst weitestgehend “betriebsblind”. Wir stecken so tief drin in unserem System, in der Routine des Man-Selbst-Seins, dass wir den sprichwörtlichen Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Oder, hier besser, unsere eigene Person vor lauter Angewohnheiten.
Das klassische Beispiel ist der Egoist, der sich im seltensten Fall seiner Verhaltensweisen bewusst ist, sich von selbst also nie als Egoisten betrachten würde – und nicht versteht, wieso er mit seinem Verhalten so oft auf Ablehnung stößt. Aber auch vermeintlich gute Eigenschaften können sich zu ungesunden Mustern entwickeln: So neigt ein sehr hilfsbereiter Mensch vielleicht dazu, ständig von sich selbst unbemerkt die eigenen Grenzen zu überschreiten und die eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen – nur, um für andere da zu sein. Obwohl er selbst unter der Situation und dem damit verbundenen Stress leidet, erkennt er sein Verhalten erstmal nicht als negativ an.
Ähnlich wie dem Egoisten oder dem übermäßig hilfsbereiten Menschen geht es dem Opfer. Und, genau wie beim selbstbezogenen Egoisten oder dem, der sein Glück daraus schöpft, anderen zu helfen, steckt auch im Opfersein ein Nutzen.
Ist man erst einmal in die Opferrolle geraten, ist es unglaublich schwer, wieder herauszukommen.
Und der Nutzen der Opferrolle? Ist bei genauerem Hinsehen gar nicht mehr so unklar:
1. Gewohnheit
So wie bei vielen Mustern spielt auch bei der Opferrolle die Gewohnheit eine große Rolle. Das kann seinen Ursprung bereits in frühester Kindheit haben: Wer schon als Kind alles von seinen Eltern oder anderen Dritten abgenommen bekam, regelrecht überbehütet wurde, hat gelernt, dass andere die Verantwortung schon übernehmen werden. Vielleicht mussten wir Schwierigkeiten nie in Eigenverantwortung bewältigen, schließlich war immer jemand zur Stelle, um uns aufzufangen und die Scherben hinter uns wegzukehren. Eine womöglich als hilfreich empfundene Erziehung kann zu einem Mangel an Selbstreflexion und Mündigkeit im Erwachsenenalter führen. Wem die Verantwortung immer abgenommen wurde, der neigt dazu, diese sein Leben lang bei anderen zu suchen – und damit seinen Mitmenschen und äußeren Umständen die Schuld für sein Glück und Unglück zu geben. Dieses Motiv der Gewohnheit wird von den Betroffenen aus Mangel an Selbstreflexion oft ebenfalls nicht erkannt.
2. Selbstschutz
Es ist simpel: Wenn wir für nichts die Schuld tragen, können wir auch nichts falsch machen. Indem wir uns in die Opferrolle begeben, die Verantwortung in die Hände eines anderen Menschen legen, schützen wir uns selbst vor Niederlagen, Versagensängsten und Unzufriedenheit. Viele schieben aus schlichter Angst vor dem Gefühl der Schuld alle Verantwortung möglichst weit von sich – um im Zweifel auch bei Niederlagen mit dem Finger auf jemand anderes zeigen zu können. Hier spielt auch der Wunsch nach moralischer Überlegenheit eine Rolle: Wenn ich nie Fehler mache, bin ich ein besserer Mensch, als die, die sie machen. Das passiert meist gar nicht mit der bewussten Absicht, anderen zu schaden, sondern vielmehr mit dem unterbewussten Ziel, sich selbst zu schützen, indem man sich in den Augen seiner Mitmenschen von Schuld und damit von moralischen Ausrutschern befreit. Dieses Verhalten folgt aus dem Trugschluss, dass die Verantwortung für eine bestimmte Situation mit Schuld gleichzusetzen ist: Die Scham über die eigene Lage ist oft so groß, dass es natürlich erleichternd ist, die Schuld dafür bei anderen zu suchen (und gegebenenfalls zu finden). Dieses Verhalten beruht auf einem Trugschluss: Selbst die Verantwortung zu übernehmen bedeutet nicht, zuzugestehen, dass man Schuld an einer Situation trägt. Es bedeutet nur zuzugestehen, dass, egal durch wessen (vermeintliche) Schuld wir leiden, wir uns nur selbst daraus wieder befreien können.
3. Identität und Anerkennung
Menschen, die schwere Situationen durchgestanden und viel Unschönes erlebt haben, erfahren dafür meist neben Hilfsbereitschaft auch Anerkennung. Unser Schmerz, den keiner nachempfinden kann, unsere Trauer, die jeden zu Boden reißen würde, macht uns einmalig und verleiht uns eine gewisse Größe und die Bewunderung anderer. Der Wunsch nach Anerkennung ist oft so groß, dass Menschen in der Opferrolle sich mit den Ereignissen, die sie vermeintlich besonders machen, identifizieren. Das Opfersein wird zur tragenden Eigenschaft, ohne die wir uns selbst nicht wiedererkennen könnten: Sobald wir alle Stärke, die wir haben, alle Aufmerksamkeit, die wir bekommen, in die Schicksalsschläge, die wir überwunden haben, projizieren – sind wir ohne sie nicht mehr wir selbst. Nicht mehr genug. Zumindest fühlt es sich für das Opfer so an, weshalb es, um sich selbst nicht zu verlieren, den eigenen Schmerz zu seiner Identität macht und aus Angst vor dem vermeintlichen Identitätsverlust auch nicht mehr davon ablässt.
4. Macht
Die Reaktion anderer auf unseren Schmerz hat einen maßgeblichen Anteil daran, dass wir gerne in der Opferrolle verharren. Wir erheben Anspruch auf Zuwendung und bekommen diese natürlich auch – womit eine enge Bindung zu den uns umsorgenden Menschen einhergeht. Interessant ist nämlich, dass in einem Szenario, in dem Anna Hilfe von Bella in Anspruch nimmt, nicht wie erwartet Anna danach eine enge Verbundenheit zur helfenden Bella verspürt. Tatsächlich ist es oft genau andersrum: Helfen wir einem Menschen, fühlen wir uns danach in der Verantwortung und damit emotional mit ihm und seinem Schicksal verbunden.
Indem wir in der Opferrolle bleiben, stellen wir sicher, dass unsere Freunde, Familie oder Kollegen ihrerseits in der Rolle des Helfenden bleiben. Dieses gängige Motiv birgt eine unschöne Wahrheit: Das Opfer neigt oft dazu, seine Situation zum Mittel emotionaler Erpressung zu machen und fortwährend die Hilfe seiner Mitmenschen zu beanspruchen. Indem es selbst kein wirkliches Interesse daran hat, die hilfsbedürftige Position überhaupt zu verlassen, sondern lieber stetig weitere Unterstützung verschiedener Personen annimmt und diese damit immer enger an sich bindet. Diese Zuwendung ist ihm nämlich vermeintlich nur sicher, solange es in der Opferrolle bleibt – und jeder, der diesem Anspruch nicht mehr gerecht werden kann oder will, wird in den Augen des Opfers selbst zum Täter. So bestärkt sich das Opfer immer wieder selbst, indem es Macht über seine Mitmenschen übernimmt und seine Opferhaltung zum Racheakt gegen diejenigen, die ihm Unrecht getan haben, macht.
Indem wir in der Opferrolle bleiben, stellen wir sicher, dass unsere Freunde, Familie oder Kollegen ihrerseits in der Rolle des Helfenden bleiben.
Das alles sind oftmals erlernte Strukturen, für die wir in der Kindheit nicht verantwortlich gemacht werden können. Im Erwachsenenalter liegt es aber durchaus innerhalb unserer Möglichkeiten, über uns selbst und die erlernten Muster hinauszuwachsen, diese alten Gewohnheiten zu durchbrechen und uns neue Verhaltensweisen anzueignen. Und natürlich, wie immer im Leben, lässt sich hier nicht pauschalisieren. Den aufgezählten, häufig zutreffenden Beweggründen gliedern sich noch unzählige weitere an, meist unerkannt und im Hintergrund laufend.
Was sich sicher sagen lässt: Fast jeder von uns konnte oder kann sich in gewissen Situationen im Leben in einem dieser Motive wiedererkennen. Nicht immer fällt das Verhalten so extrem und eindeutig aus, wie beschrieben, und nie (!) ist es ein zwingendes Zeichen für schlechten Charakter, Ungenügen oder Feigheit. Was uns ausmacht, ist wie wir mit solchen Erkenntnissen umgehen: Ob wir das Opfersein in Kauf nehmen, um seinen (negativen) Nutzen zu erzielen – oder ob wir das neu gewonnene Bewusstsein über die Problematik lieber als Sprungbrett betrachten, um uns aus ihr herauszukämpfen.